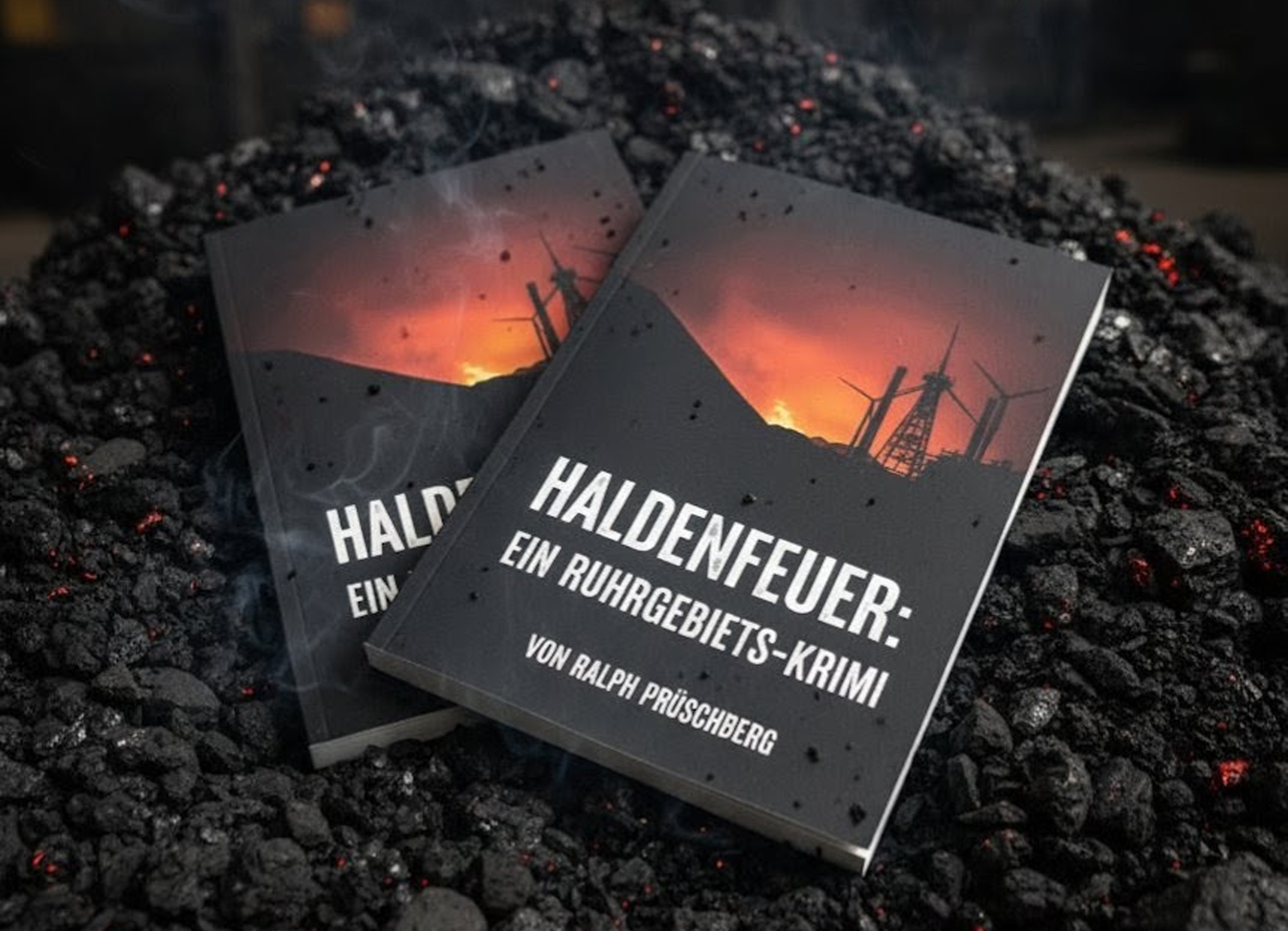Hi che,
ich hab grad mal im „Der Möbelbau“ von Fritz Spannagel von 1936 nachgeschaut:
>>Als Leimsorten stehen die Glutinleime, also Haut-,Leder- und Knochenleime
immer noch an erster Stelle........
Nächst dem Glutinleim kommt der Kaseinleim, meist einfach Kaltleim genannt, zur Verwendung.
…. wegen höherer Beständigkeit Witterungseinflüssen gegenüber angewendet ...
In Hinblick auf Wasserfestigkeit... ist ihm inzwischen ein Konkurrent in den Kunstharzleimen
entstanden, der seine (des Kaseinleims) Nachteile, Verfärben, Neigung zu Bakterien- und Schimmelbefall, nicht hat.<<
Bei aller Liebe zur Authentizität würde ich keinen Knochenleim mehr „kochen“.

Wichtiger beim Verleimen ist es, dass die Klebflächen saugfähig sind,
d.h. keine Knochenleimreste oder andere Leimreste drauf bleiben.
Andererseits sollte die Passung so optimal sein, dass der Leim ins Holz eindringen kann.
Das betont auch Spannagel im Zusammenhang der Verleimung von Holzverbindungen,
speziell bei Zapfen und Zapfenloch:
>> Es ist naheliegend, daß die Verleimung nur dann eine gute ist,
wenn die einzelnen ineinandergreifenden Holzteile so genau gearbeitet sind,
daß gleich wie bei der Fuge der Leim in die Poren gepresst wird.<<
Sonst gäbe es nur eine "Verkittung" und keine Verlleimung.
Natürlich beide Teile mit Leim einstreichen. Das sagt er auch noch dazu.
Aber das steht ja auf jeder P-Flasche auch drauf.
Bei Stühlen ist, je nach Bauart, mit Zwingen keine künstliche Druckerhöhung in den
Zapfenverbindungen möglich.
Hier tut sich ein Widerspruch auf: Durch das Säubern der Klebestellen geht natürlich Material
verloren und dadurch wird die Passung schlechter.
Das macht das „Stühle neu verleimen“ zu einer so undankbaren und aufwendigen Sache.

Auch wenn nur ein Bein locker ist, musst Du je nach Bauweise, mindestens noch ein anderes lösen,
um richtig an die Klebestellen zu kommen.
Das Möbelbuch von Fritz Spannagel lässt sich zu Teilen auch als PDF-Datei runterladen,
auch bei Gurgel-Books kriegt man einige Seiten.
Gruß
vom Lins