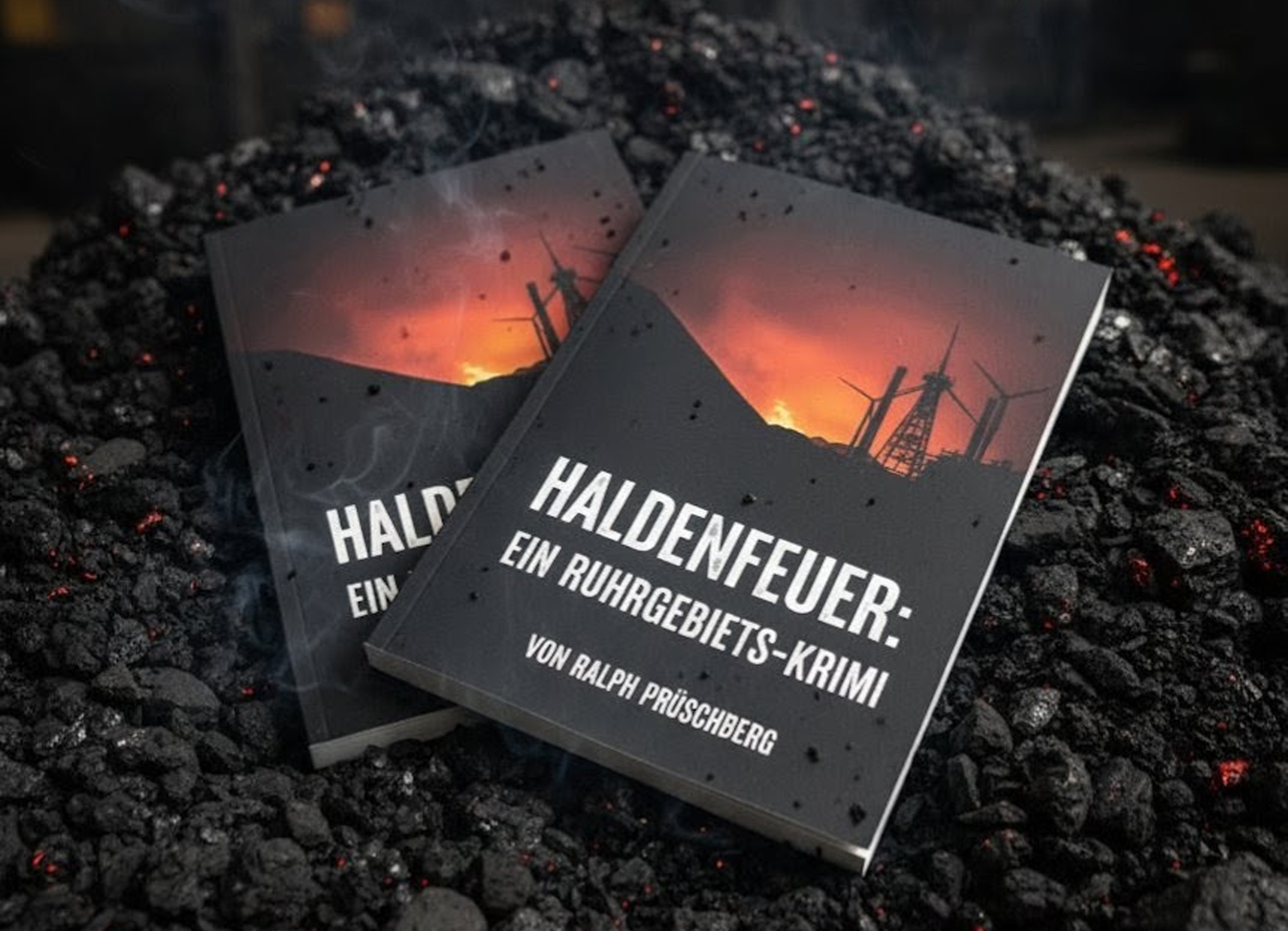marker hat geschrieben: ↑Sonntag 4. September 2022, 07:51
Da war natürlich auch viel Vertrauen mit im Spiel, denn letztendlich kontrollierten sich die Gold- und Silberschmiede ja selber. Und Selbstkontrolle ist immer so 'ne Sache... Gruss marker
Diese Selbstkontrolle funktionierte meistens sehr gut, denn im Grunde konnte die Konkurrenz aus anderen Städten diese Probe an Objekten durchführen, die das Beschauzeichen einer bestimmten Stadt trugen, um festzustellen, wie gründlich die gearbeitet hatten. Wenn sich dann herausgestellt haben sollte, dass betrogen worden ist, war der Ruf einer Zunft einer Stadt schnell ruiniert und das war eine gute Motivation für die Prüfer, das zu verhindern.
Einen schlechten Ruf sagt man ja den Goldschmieden in Schwäbisch Gmünd nach, so dass selbst Goethe schrieb:
"Bist du Gemündisches Silber, so fürchte den schwarzen Probirstein
Kotzebue, sage, warum hast du nach Rom dich verfügt?"
[Gäste sehen keine Links]
Du kannst davon ausgehen, dass dieser Verlust der Reputation nur schwer wieder hergestellt werden kann.
Wer sich dazu vertiefen möchte (die OCR hat nicht überall gut gearbeitet)
[Gäste sehen keine Links]
---
Wie sehr sich seit diesem Jahre das dortige Gewerbe unter geschickter Benutzung des
langjährigen Verbotes aller französischen Bijouteriewaren entwickelt hat, ist daraus zu
ersehen, daß es im Herbst 1695 nicht weniger wie 13 Schwäbisch-Gemündener Silberhändler waren, welche erneut ermahnt wurden, sich nicht mehr mit geringhaltigen Silberwaren
hier einzufinden. Trotzdem ergab eine in der folgenden Ostermesse bei 15 Händlern vorgenommene Probe meist nur 11 Lötige, betrügerische Ware: von außen her sei sie zwar. mit einem silbernen Blättlein überzogen, sodat3 es sich 1 llötig streichen lasse; wenn aber die
Arbeit gebrochen werde, so finde sich viel falsch Lot dabei, sodaß, wenn solch' Gemündener Silber in den Tiegel geworfen und geschmolzen werde, die Hälfte verloren gehe und
keine 7 Lot gefunden würden. Hierauf wurde das Edikt von 1614, wonach auch die fremden Silberhändler nur 13lötiges Silber verkaufen dürfen, erneuert. Im Jahre 1713 beschwerten sich die Goldschmiede-Geschworenen wiederum über die geringhaltigen Silberwaren des Adolf Ziegler und anderer Händler von Schwäbisch-Gemünd. Es fanden sich
Löffel, Schuhschnallen, Kreuzlein, Hemdenknöpfe, Anhänger, Nadelbüchschen, inwendig
vergoldete gedrehte Fingerhüte und ein Schwammbüchslein von nicht mehr als 2 Lot 8
Grän vor. Wegen seines geringhaltigen Silbers wurde 1730 Simon Geyger aus dieser Stadt
zu 100 fl. Strafe verurteilt. Seitdem blieben die Schwäbisch-Gemündener Silberfabrikanten
unbehelligt. Der Handel mit kleinen geringhaltigen, nicht nach dem Gewicht verkauften
Galanteriewaren ließ sich nicht länger verbieten.